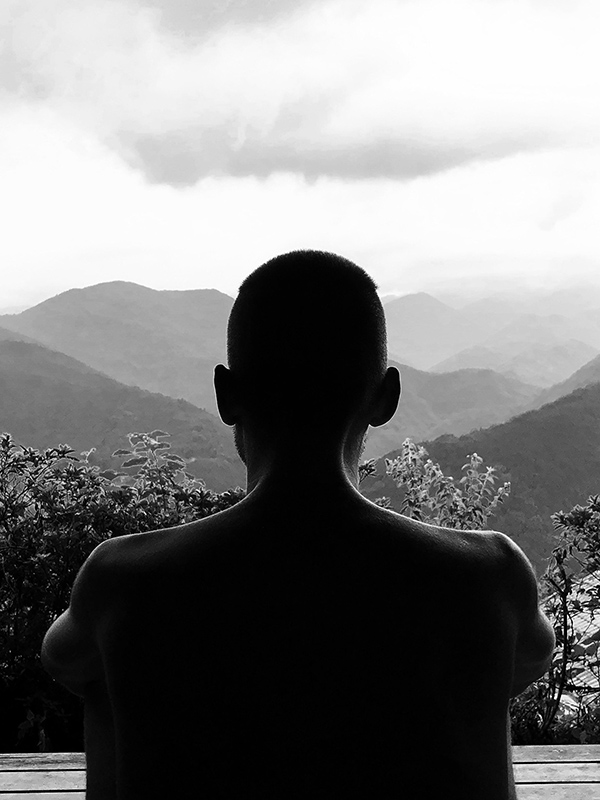Neapel ist eine Art zusammengeschmolzener Klumpen der vergangenen zweitausend Jahre am Mittelmeer. Wohnhäuser, Fahrzeuge, Marktstände, Statuen, Pflanzen – alles ist Teil eines gleichen, texturierten Stadtmaterials. Vollkommen unbekannt ist die lineare Folge von Straßen zu Plätzen zu Bauten, wie man sie aus dem irgendwann in die Pläne einer aristokratischen Klasse gezwungenen Inneren großer europäischer Städte kennt.
Vielmehr entspricht Neapel dem unüberblickbaren Gewirke ostasiatischer Großstädte: geeignet, Invasoren zu desorientieren, ohne Unterscheidung zwischen Infrastruktur, Architektur und privat organisiertem Räum. Bauten sind Material, Ruinen sind Material, Märkte und andere temporäre Raumorganisationen sind Material. Via San Antonio Abate ist näher an der Jalan Tun Razak als am Place d‘Aligre. Neapel altert uniform, in einer gleichmäßigen Patina aus Sandsteinschmirgel, Schwärzung und Bruch; die Übergänge sind fließend. Mit jedem Tag schreibt sich das Gefüge der Stadt tiefer in sich selbst ein, Wildnis, Steppe.
Die Straßen Neapels sind der Ort der Performance (und der Ort für alles Andere), wie das häufig der Fall ist in Städten, in denen um vieles gekämpft werden muss. Was Stil angeht, fallen zwei Dinge auf.
Erstens: Die überzeichnete Silhouette der Ramones-Sneaker von Rick Owens hat in Neapel die subtilere des Converse-Originals abgelöst. In einer Art Möbiusschleife kultureller Referenzierung ist die Comic-Version des simplesten Sneakers der Welt hier wieder angekommen und zum Default geworden: Der 25-Euro-Fake eines Luxusprodukts, das vermutlich weder seinen ostasiatischen Herstellern noch seinen Käufern bekannt ist. Jede Altersgruppe trägt die massiven weißen Sohlen und den Zip auf der Innenseite – mutmaßlich ohne den Versuch, Status und Geld zu demonstrieren, sondern aus Lust an der Lautstärke, an Präsenz und Sichtbarkeit.
Zweitens: Pyrex‘s not dead. Das (Fake-) Echo1 von Virgil Abloh‘s Streetwear-Versuch hallt durch die neapolitanischen Straßen, das Momentum der Beflockungsmaschinen war zu groß, sie laufen weiter. Gemüsehändler tragen die Shirts zur Arbeit, ihre Freundinnen die Trainingshosen zu Pumps. PYREX, eine Reihe ziemlich guter Buchstaben, der Name eines Kochtopfherstellers, encodiert von Pushern und Tickern, gesampled, geflockt, gefaked, cargo-kultiviert am südlichen Ende des geistigen Europas. Semiotik kann schwindelerregend sein.