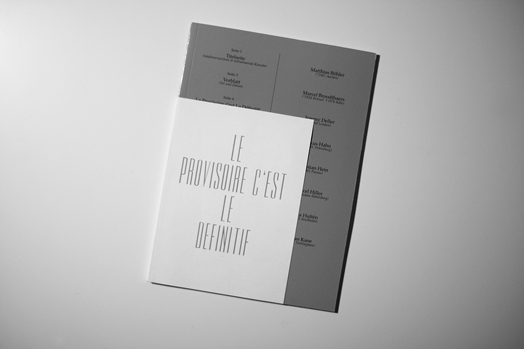Die Idee der reinen Form, also auf sich selbst bezogene Ästhetik, ist ein unterhaltsames Klischee der Designmythologie (aber bitte nicht mit „Kunst“ zu verwechseln). Es ist eine äußerst entspannende Tätigkeit, Fragen nach dem was mit einem wie zu beantworten. Also inhaltliche Fragen mit formalen Antworten zu versehen – nicht zuletzt, weil diesem Maneuver selbst eine gewisse Eleganz innewohnt.1 Um Kopfschmerzen am nächsten Morgen zu vermeiden, ist es darüber hinaus eine gute Idee, entsprechende Entwürfe von vornherein vom Anspruch auf Dauer zu befreien. Kunst des Verschwindens.
Ich meinem Kopf verwende ich seit einigen Jahren den Begriff des Pavillons, um Gestaltung, Gedanken und haltloses Fabulieren in diese Richtung zu benennen. In der Architektur ist der Pavillon eine maximal bedeutungsoffene Struktur. Er kann beliebigen Zwecken dienen oder nicht-dienen, seine Gestalt hat keine essentiellen Elemente. Sein späteres Verschwinden ist Teil des Plans. Der Pavillon ist die Lösung eines Problems, das (noch) nicht existiert, er ist in jedem Fall progressiv.
Im reißenden Bewustseinsstrom von Hans-Ulrich Obrist gibt es eine schöne Beschreibung dieses Gedankens (April Lamm [Ed.], Everything You Always Wanted to Know About Curating):
I think the most underrated aspects of architecture’s presence are pavillons and exhibition design. […] What’s interesting is that these ephemeral, nonpermanent architectures throughout history have very often created a lasting effect and contributed to the discourse of architecture. […] They become part of the canon and push the envelope of what architecture can be. […] Exhibition pavillons in the twentieth century acted as sites for the incubation of new forms of architecture that were sometimes so shocking original and so new that they were not even recognized as architecture at all.
Es sind mehr Pavillone zu bauen. Stilisierte Gebilde, geschichtet um eine leere Mitte. Gleichwohl nicht ohne Sinn, aber ohne unmittelbaren Sinn. Übungen für zukünftige Probleme. Eine Tätigkeit wie ein Dojo, das man besucht, um Kraft zu gewinnen. Ein Raum, in dem das Prinzip des Samurai Yamaoka Tesshū für kurze Zeit erreichbar ist – no-sword, no-enemy, purity of style is all that is needed.
Derlei sind wiederum recht nah nah an der japanischen Idee Oku, die die Leere als idealen Kern für elaborierte Entwürfe begreift. ↩︎